 |
|||||||
Bern von Bümpliz' Gnaden?
Als Mittelpunkt eines herrschaftlich organisierten Güterkomplexes ist die Curtis oder Curia von Bümpliz erst vom 14. Jahrhundert durch Originalurkunden belegt. Nachweisbar hat aber Rudolf der III. in Bümpliz Urkunden ausgestellt. Die Ausgrabungen von 1970 zeigen, dass der Standort der 1306 bezeugten "Curtis imperii de Bimplitz" mit dem Areal des alten Schlosses identisch ist. Offen ist, wer den Bau der Curtis veranlasste.
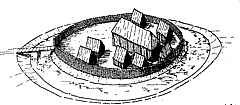
Das Alte Schloss in seiner 1. Periode; Rekonstruktionsvorschlag von W. Meyer.
Über den Umfang
des Königsgutes Bümpliz wurden bisher keine direkten Nachrichten
aus dem Mittelalter gefunden. Analysen aus späteren Dokumenten lassen
aber den Schluss zu, dass der Güter- und Rechtsverband des Hofes
Bümpliz nördlich durch den Bremgartenwald, westlich durch den
Forst, südlich durch das Wangental und den Könizberwald und
östlich durch die Aare begrenzt waren. Vermutet wird, dass demzufolge
auch der Boden, auf dem Bern gegründet worden ist, zum Reichsgut
von Bümpliz gehören könnte.
Dass König Rudolf III. (genannt der Faule) bei seinen Reisen nicht
in einer festen Burg, sondern in den mit Palisadenzaun und Wassergraben
befestigten Holzbauten in Bümpliz absteigen musste, illustriert den
eher geschwächten Zustand, in dem sich das Haus Burgund damals befunden
haben muss.
Mit dem Tod Rudolfs
versank der Reichshof Bümpliz für längere Zeit im Dunkeln
der Geschichte. Fest steht, Bümpliz war keine Pfalz. Der König
ist dort weder länger verweilt noch wurde richtig hofgehalten.
Mit dem Bau des zentralen Rundturms um 1255 änderten sich die Wohnverhältnisse in Bümpliz schlagartig. Vermutlich residierte in jener Zeit ein niederadliger Burgvogt in Bümpliz. Die Umgestaltung des Hofes um 1471 bedeutete einen entscheidenden Einschnitt in der herrschaftlich-repräsentativen Nutzung.
Adelsschloss und
Anstalt
Der eigentliche Ausbau der Anlage zum Schloss geht auf die Dynastie der
von Erlachs zurück. Mit dem Anwesen, das der Junker Franz Ludwig
von Erlach (1596-1650) für seine 13 Kinder aus drei Ehen ausbauen
liess, erreichte das Alte Schloss seine grösste Ausdehnung und Blüte.
Was später geschah, zählt die Kunsthistorikerin Johanna Strübin
Rindisbacher zur «Abbruchgeschichte». Im 19. Jahrhundert liess
der Psychiater Johann Friedrich Tribolet gar eine «Heilanstalt für
Gemütskranke» einrichten. Vom Glanz blaublütiger Herrschaft
war mithin nichts mehr zu spüren.

Quelle: Meyer/Strübin; "Das Alte Schloss Bümpliz",
Paul Haupt, 2002.
